Die Mühen der Ebene nach dem spektakulären Anfangserfolg in Sachen Gleichberechtigung
22.05.2019 — Ulrike Schultz, Sabine Berghahn. Quelle: Verlag Dashöfer GmbH.
Sabine Berghahn (SB): Am 23. Mai 2019 jährt sich die Verkündung des Grundgesetzes zum 70. Mal. Das ist ein bedeutendes Datum auch und gerade für die Gleichberechtigungsentwicklung in Deutschland! Fangen wir also mit dem spektakulären Anfangserfolg der Frauen an …
Ulrike Schultz (US): … der ganz eindeutig Elisabeth Selbert zu verdanken ist, die als richtige Person, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war!
Elisabeth Selbert, promovierte Juristin und SPD-Mitglied, war eine von nur vier Frauen im Parlamentarischen Rat, dem Gremium, welches das Grundgesetz ausarbeiten sollte. Elisabeth Selbert hat dort fast im Alleingang die umfassende Formel: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ als Gegenvorschlag zu einer von den Männern vorgesehenen Neuauflage der Weimarer Formel von der nur „staatsbürgerlichen Gleichberechtigung“ durchgesetzt. Für sie war es „eine Selbstverständlichkeit, dass man heute weitergehen muss als in Weimar und dass man den Frauen die Gleichberechtigung auf allen Gebieten geben muss. Die Frau soll nicht nur in staatsbürgerlichen Dingen gleichstehen, sondern muss auf allen Rechtsgebieten dem Manne gleichgestellt werden.“
Anfangs musste sie sogar ihre Parteigenossin Frieda Nadig von der Wichtigkeit ihres Vorschlags überzeugen, die – ähnlich wie auch männliche Ratsmitglieder – befürchtete, dass das einschlägige, die Frauen benachteiligende Gesetzesrecht, insbesondere das BGB-Ehe- und Familienrecht, dann schlagartig verfassungswidrig wäre und ein rechtliches Vakuum eintreten würde. Da mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz juristisches Neuland betreten werde, seien die Folgen unabsehbar. Die beiden anderen Frauen im Parlamentarischen Rat, Helene Wessel und Dr. Helene Weber, die dem Zentrum und der CDU angehörten, konnte Elisabeth Selbert wegen deren grundsätzlichen Geschlechterverständnisses nicht auf ihre Seite ziehen. Die meisten männlichen Mitglieder der Kommission, auch viele von der SPD, lehnten eine umfassende Gleichberechtigung von Männern und Frauen als zu weitgehend ab. Insbesondere fürchteten auch sie, dass das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in weiten Teilen verfassungswidrig würde. Ausgerechnet das BGB, das nach 30 Jahren Ausarbeitung am 1. Januar 1900 in Kraft getreten war und somit ein zivilrechtliches Paradegesetz und eine stolze Konstante im deutschen Rechtssystem darstellte, welches durch den Nationalsozialismus ohnehin stark diskreditiert war, sollte nicht beschädigt werden. Wenn Frauen mehr als das Wahlrecht und die aktive und passive Staatsbürgerschaft bekommen würden, nunmehr wenigstens ohne den einschränkenden Zusatz der „grundsätzlich“ gleichen Rechte, so müssten Frauen auch in den zivil-, d.h. vor allem familien- und arbeitsrechtlichen Bereichen Männern gleichgestellt werden. Damit bräche aber womöglich das Chaos in der gesamten Rechts- und Gesellschaftsordnung aus!
SB: Ulrike, Du hast dich eingehend mit der Anfangsgeschichte des Art. 3 Abs. 2 GG beschäftigt. Wie hat Selbert es hinbekommen, dass der umfassende Gleichberechtigungsgrundsatz in das Grundgesetz aufgenommen wurde?
US: Elisabeth Selbert, Landtagsmitglied in Hessen, war 1948 übrigens nur mit knapper Not auf Intervention der zentralen Frauensekretärin der SPD, Herta Gotthelf, und auf Druck von Kurt Schumacher für den Parlamentarischen Rat benannt worden und zwar für Niedersachsen, da die Plätze für Hessen bereits besetzt waren. Sie hat selbst gesagt, dass sie den „Kampf mit den Gewalten aufnehmen“ musste. Da der Widerstand im Parlamentarischen Rat zu groß war, musste sie außerparlamentarischen Protest initiieren. Mitglieder überparteilicher Frauenverbände, Politikerinnen und Gewerkschafterinnen wurden mobilisiert und haben – was inzwischen sprichwörtlich geworden ist – waschkörbeweise Protestschreiben an den Parlamentarischen Rat geschickt, um Selberts Formulierungsvorschlag zu unterstützen.
Elisabeth Selbert war zu der Zeit übrigens eine der wenigen Frauen mit juristischer Ausbildung. Die Nazis hatten eine Begrenzung der Zulassung von Frauen zu den Universitäten verfügt und Frauen ab Mitte der 1930er Jahre von juristischen Tätigkeiten ausgeschlossen. Abgesehen davon gab es auch vor 1933 kaum Juristinnen, da erst ab 1922 Frauen zu den juristischen Staatsexamina zugelassen worden waren. 1934 erhielt Elisabeth Selbert als eine der letzten Frauen ihre Zulassung als Anwältin. Sie hatte 1930 über „Ehezerrüttung als Scheidungsgrund“ promoviert und hatte damit eine Regelung vorweggenommen, die erst fast 50 Jahre später, im Ersten Gesetz zur Änderung des Ehe- und Familienrechts von 1976 (in Kraft getreten am 1.7.1977) das alte Verschuldensprinzip abgelöst hat.
SB: Schon damals bediente sich Selbert also einer Doppelstrategie, nämlich parallel zur Argumentation im Parlamentarischen Rat öffentlichen Druck aufzubauen, indem sie eine Flut von Eingaben und Forderungsschreiben von Frauen organisierte, was auch bei der Durchsetzung späterer Gesetzgebungsvorhaben zugunsten von Frauen erfolgreich war.
US: In der Tat haben die Waschkörbe voller Schreiben die Mitglieder des Parlamentarischen Rats so beeindruckt, dass die Schlussabstimmung im Hauptausschuss sogar einstimmig ausfiel. Zuvor hatte Selbert aber Abstimmungsniederlagen im Ausschuss für Grundsatzfragen und auch bei einer ersten Abstimmung im Hauptausschuss kassiert, obwohl sie dort leidenschaftlich gekämpft hatte: „In meinen kühnsten Träumen habe ich nicht erwartet, dass der Antrag (...) abgelehnt werden würde. (...) Die Frau, die während der Kriegsjahre auf den Trümmern gestanden und den Mann an der Arbeitsstelle ersetzt hat, hat heute einen moralischen Anspruch darauf, so wie der Mann bewertet zu werden.“ Sie hatte auch auf die Macht der Frauen hingewiesen, dass nämlich bei Wahlen mit den Stimmen der Wählerinnen gerechnet werden müsse „und wir auf 100 Wähler 170 Wählerinnen rechnen“. Erst der überwältigende Protest der Frauen aus allen Regionen des Landes half.
SB: Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident, bezeichnete die Kampagne im Nachhinein dann jedoch als „Quasi-Stürmlein“ und meinte, man hätte Selberts Vorschlag auch ohne dies zugestimmt. Ulrike, wie interpretierst du diese Bagatellisierung? Ist das typisch für die Reaktion von Männern, wenn Frauen mal einen politischen Sieg erringen?
US: Niederlagen, zugefügt vom „schwachen Geschlecht“, haben sich die starken Männer ungern eingestanden, und so ist es auch heute oft noch. Daher wurde der Erfolg der Frauen heruntergespielt, diese fundamental wichtige Rechtsfrage der Gleichberechtigung verniedlicht. Kurt Schumacher bezeichnete sie später als „Detailfrage“. Das zeigt auch exemplarisch, wie schwierig es war – und ist – Frauenforderungen durchzusetzen.
SB: Ist es dann auch typisch gewesen, wie die anfängliche Errungenschaft der vollständigen und umfassenden Gleichberechtigung in den ersten Jahrzehnten der bundesrepublikanischen Geschichte fast vergessen gemacht wurde? Und wer oder was half in dieser bleiernen Zeit der Restauration und Wiedereinsetzung männlicher Dominanz?
US: Hilfe bekam sie schon während der Beratungen des Parlamentarischen Rates durch Wiltraud Rupp von Brünneck, die spätere zweite Richterin am Bundesverfassungsgericht (von 1963-1977). Auf ihren Rat hin hat Elisabeth Selbert nämlich flankierend zu Art. 3 Abs. 2 – den Bedenken von Frieda Nadig Rechnung tragend – Art. 117 Abs. 1 GG entworfen, der besagt: „Das dem Art. 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953.“ Diese Übergangsbestimmung sollte das befürchtete Rechtschaos vermeiden.
Bis zum Stichtag Ende März 1953 war aber nichts geschehen, weil der Bundestag als Gesetzgeber anderen Gesetzesvorhaben Präferenz gegeben hatte. Ein Gericht legte dem Bundesverfassungsgericht sogar die Übergangsregelung zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit vor, das die Regelung im Dezember 1953 aber als verbindlich bestätigte und sogar Gerichte ermächtigte, in der Zwischenzeit bis zum Inkrafttreten des in Art. 117 GG versprochenen Gesetzes eigenständig über die Verfassungskonformität oder -widrigkeit einzelner vorkonstitutioneller Normen zu ent-scheiden. Dadurch wurde z. B. das männliche Recht zur Verwaltung und Nutznießung am Vermögen der Frau, das das alte BGB vorsah, für verfassungswidrig erklärt.
SB: Ein Rechtschaos trat also nicht ein. Es blieb beim Alten, und Frauen mussten aber erneut kämpfen, damit überhaupt etwas voranging. Warum hat die eigentlich anstehende Anpassung der Gesetzgebung an den Gleichberechtigungsgrundsatz so wenig öffentliche Aufmerksamkeit gefunden?
US: Gesellschaftlich regte sich zunächst wenig Unmut über die Zustände, die untätige Politik und den im Grunde verfassungswidrigen Rechtszustand. Die Nachkriegsjahre waren in der Tat eine Phase der konservativen Restauration, und entsprechende Familienmodelle mit traditionellen Vorstellungen vom trauten Heim und männlichem Familienvorstand wurden bevorzugt. Bei uns im Ruhrgebiet waren die Kumpel stolz darauf, wenn ihre Frauen nicht arbeiten mussten. Solche Vorstellungen waren gesellschaftlich insgesamt weit verbreitet trotz der vielen Kriegerwitwen, die ihre Familien allein durchbringen mussten. Es grassierte das böse Wort von den Schlüsselkindern, deren Mütter sie wegen ihrer Berufstätigkeit nachmittags nach Schulschluss allein zu Hause sitzen ließen. Selbst nach der Inkraftsetzung des Gleichberechtigungsgesetzes Mitte 1958, also gut fünf Jahre zu spät, regte sich wenig Protest gegen die immer noch existierenden Frauendiskriminierungen im Recht.
Erst das engagierte und zähe Durchfechten von gerichtlichen Klagen, in denen die rechtliche Benachteiligung von Frauen zum Tragen kam, oft durch die Instanzen hindurch bis zum Bundesverfassungsgericht, führte zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Normen in verschiedenen Gesetzen – nicht nur im Familienrecht. Das Verdienst kam in erster Linie Anwältinnen zu, und dabei vor allem einigen von denen, die den Deutschen Juristinnenbund, der nach der Machtergreifung durch die Nazis aufgelöst worden war, 1948 neu gegründet hatten.
In solchen Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht u. a. festgestellt:
1957 dass die z. T. steuererhöhende Zusammenveranlagung von Ehepaaren nicht den in Art. 3 und 6 GG niedergelegten Grundsätzen der Geschlechtergleichberechtigung und dem Schutz der Ehe entsprach, weil auch Frauen ein gleiches Recht auf Erwerbseinkommen haben sollten, woraufhin das Ehegattensplitting gesetzlich als Kompromiss zwischen Besteuerung nach Leistungsfähigkeit, Gleichberechtigung von Frauen und der politischen Begünstigung der Hausfrauenehe eingeführt wurde, das uns heute allerdings im Hinblick auf die angestrebte finanzielle Unabhängigkeit von Ehe- wie Lebenspartnern viel Kopfzerbrechen macht,
1959 dass der sog. Stichentscheid des Vaters in Fragen der elterlichen Gewalt und sein alleiniges Vertretungsrecht für die Kinder verfassungswidrig sind, obwohl diese Normen noch zwei Jahre vorher 1957 mit dem Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet worden und zum 1. Juli 1958 in Kraft getreten waren,
1963 dass die sog. Höfeordnung (gültig in Teilen Norddeutschlands) mit Bevorzugung des männlichen Erben verfassungswidrig ist,
1963 dass es verfassungswidrig ist, wenn der Wert der Leistung von Müttern, Hausfrauen und Mithelfenden in der Sozialversicherung (bei der Ausgestaltung der Witwen- und Waisenversorgung) unberücksichtigt bleibt,
1967 dass Beamtinnen hinsichtlich der Versorgung ihrer nächsten Familienangehörigen ihren männlichen Kollegen gleichzustellen sind. Dieses schuf die Grundlage für das beamtenrechtliche Witwergeld,
1974 dass in gemischt nationalen Ehen nicht nur Kinder deutscher Väter, sondern auch Kinder deutscher Mütter deutsche Staatsangehörige werden können. (Nicht zu vergessen ist, dass erst aufgrund des zum 1. Juli 1970 in Kraft getretenen Gesetzes über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder diese mit ihren Vätern verwandt geworden sind.),
1991 dass Ehepartner ihre Namen bei Eheschließung behalten können und der Vorrang des Mannesnamens entfällt (für den Fall, dass sich die Eheleute nicht auf einen gemeinsamen Ehenamen einigen können),
1992 dass Kindererziehungszeiten als echter Beitrag zur Rentenversicherung zu 100 Prozent der (durchschnittlichen) Entgeltpunkte und nicht nur zu 75 Prozent angerechnet werden müssten.
SB: Waren es in den ersten Jahrzehnten nach 1949 nicht wieder das alte BGB mit seinem anti-quierten Ehe- und Familienrecht, z. B. der „Hausfrauenehe“, und der Abtreibungsparagraph 218 StGB, mit denen die nach Gleichberechtigung und Freiheit strebenden Frauen niedergehalten wurden?
US: Bis zur sog. großen Ehe- und Scheidungsrechtsreform von 1976, in Kraft ab 1. Juli 1977, die auch weitere Normen des Familienrechts veränderte, war für einige Bestimmungen im Ehe- und Familienrecht die Verfassungswidrigkeit festgestellt worden, der Gesetzgeber hatte aber noch keine neuen erlassen. Ich erinnere mich, dass in meiner Ausbildung in unseren Texten vom BGB diese Bestimmungen kursiv geschrieben waren. Ob nun die vorhandenen gesetzlichen Regelungen die Frauenemanzipation behindert haben oder insgesamt die patriarchal geprägte Gesellschaft den Fortschritt aufgehalten hat, ist schwer zu sagen. Beides hat zusammengespielt. In der Tat war bis 1977 im Ehe- und Familienrecht das Leitbild der Hausfrauenehe festgeschrieben. Zwar hatten seit dem Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes im Jahr1958 Männer nicht mehr das Recht, (mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts) eigenmächtig Arbeitsverhältnisse der Ehefrau zu kündigen. Wenn aber ihre Frauen die Pflichten in Ehe und Familie aufgrund ihrer Berufstätigkeit vernachlässigten, konnten sie deswegen u. U. schuldig geschieden werden. Solche Fälle waren nicht häufig, man darf aber nicht die Symbolkraft von Gesetzen unterschätzen, vor allem wenn sie noch Ausdruck von verbreiteten gesellschaftlichen Vorstellungen sind.
Eine wichtige Befreiung für die Frauen war die Erfindung der Anti-Baby-Pille, die ab den 1960er Jahren das Leben für sie planbarer machte. Dennoch war der Abtreibungsparagraph, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht 1975 und 1993 befasst hat, eine Bedrohung der Entscheidungsfreiheit und Eigenständigkeit.
US: Dies führt zu einer Frage an Dich, Sabine. In der DDR wurde das Abtreibungsverbot ab 1972 partiell aufgehoben. Wie ist dort die Entwicklung verlaufen?
SB: In der DDR verlief die Gleichberechtigungsentwicklung zum Teil anders: Die DDR wurde ein knappes halbes Jahr später gegründet als die Bundesrepublik und gab sich eine Verfassung, in der ebenfalls die umfassende Gleichberechtigung von „Mann und Frau“, wie es damals generalisierend hieß, fest- und vorgeschrieben wurde. Die der Gleichberechtigung entgegenstehenden Vorschriften der Rechtsordnung wurden sogar durch den Verfassungstext sogleich aufgehoben. Allerdings blieb dabei unklar, welche Normen das im Einzelnen sein sollten und was an ihre Stelle treten würde. Dafür mussten die Grundlagen auch erst später geschaffen werden.
US: Welche Schritte unternahm die DDR zur Umsetzung der Gleichberechtigung und tat sie sich leichter damit als die Bundesrepublik?
SB: Sie tat sich leichter, weil sie – angesichts der führenden Rolle der Partei SED – im Wesentlichen einfach dekretieren konnte und die im Politbüro beschlossenen Maßnahmen in der Volkskammer auch durchsetzen konnte. Es gab früher als in der Bundesrepublik entsprechende Reformen im Ehe- und Familienrecht, die Zerrüttungsscheidung wurde beispielsweise schon 1955 eingeführt, aber es gab auch Bevölkerungsumfragen, die zur Rücknahme von egalitären Vorschlägen aus dem Entwurf für das 1965 geschaffene und 1966 in Kraft getretene Familiengesetzbuch führten, z. B. im Ehenamensrecht. Auch in der DDR war die Bevölkerung eher konservativ. Der Staat förderte die Erwerbstätigkeit von Frauen, nicht in erster Linie als Ausdruck von beruflicher Selbstverwirklichung, sondern vor allem, weil Arbeitskräfte infolge der Abwanderung und Flucht in den Westen fehlten. Das Abtreibungsrecht wurde schon vor 1972 mehrfach verändert, lange Zeit wollte die führende Partei jedoch die Strafrechtsdrohung nicht aussetzen. Das führte dazu, dass es noch viele illegale Abbrüche gab, die die Gesundheit der Frauen schädigten, die zu Fehlzeiten im Arbeitsverhältnis führten und außerdem mit einem Geburtenrückgang einhergingen. Nach der Ablösung von Walter Ulbricht durch Erich Honecker (1971) ließ das Zentralkomitee der SED eine Fristenregelung mit der im Wesentlichen selbstbestimmten Entscheidungsmöglichkeit der schwangeren Frau in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft – insbesondere durch die Funktionärin Inge Lange – ausarbeiten. Die Fristenregelung wurde dann im März 1972 von der Volkskammer verabschiedet. Da gab es zum ersten Mal Gegenstimmen und kirchliche Proteststellungnahmen. Die Regelung war jedoch ein praktischer Fortschritt und verwirklichte gleichzeitig ein altes Versprechen der kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien aus der Zeit der Weimarer Republik.
US: In den 1970er Jahren gab es ja geradezu eine Reformkonkurrenz in Sachen Abtreibung …
SB: Tatsächlich reformierten in den 1970er Jahren zahlreiche Staaten in Europa und auf der Welt ihre Abtreibungsregelungen, insofern lag die DDR-Fristenregelung positiv im Trend. In der Bundesrepublik wurde zwar 1974 ebenfalls eine Fristenregelung vom Bundestag verabschiedet, sie konnte aber nicht in Kraft treten, weil drei Landesregierungen und CDU/CSU-Abgeordnete eine abstrakte Normenkontrollklage erhoben hatten und das Karlsruher Gericht im Februar 1975 die Fristenregelung gänzlich einkassierte. Stattdessen musste dann 1976 eine Indikationsregelung (mit vier Indikationen) gesetzlich verankert werden. In ähnlicher Weise grätschte auch 1992 das Bundesverfassungsgericht in Gestalt seines Zweiten Senats in den Gesetzgebungsprozess, der mühsam aber demokratisch vorbildlich einen Kompromiss hervorgebracht hatte, mit dem auch DDR-gewohnte Frauen hätten leben können. Wieder hatte nämlich die unterlegene Bun-destagsminderheit von CDU/CSU eine Verfassungsklage erhoben. Heraus kam 1993 die in sich widersprüchliche Formel des Bundesverfassungsgerichts „rechtswidrig, aber straflos“, die dann 1995 in Gesetzesform gegossen wurde.
Abgesehen von der Liberalisierung der Abtreibung 1972 bot der DDR-Staat Frauen eine Reihe von sozialpolitischen Förder- und Erleichterungsmaßnahmen, um ihnen die Vereinbarung von Beruf und Familie bzw. Kinderbetreuung zu ermöglichen, und er unterstützte die berufliche Qualifizierung von Frauen. Diesbezüglich hat die DDR die tatsächliche Umsetzung der Gleichberechtigung für das Erwerbsleben und für Bildung und Ausbildung schon 1968 in der novellierten Verfassung als Ziel festgeschrieben.
US: Dann kam 1990 die Wiedervereinigung und seitdem gibt es eine gemeinsame, wenn auch nicht wirklich gleiche Entwicklung der Gleichstellung in Gesamtdeutschland.
SB: Fragen wir jetzt also, welche wichtigen Stationen in Gesetzgebung und Rechtsprechung hier zu nennen sind? Und wer hat die Entwicklung reformerisch vorangetrieben?
US: Für die Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes und Anpassung des Rechts waren häufig Bündnisse der Frauenverbände mit Parlamentarierinnen, deren Anzahl seit den 1980er Jahren endlich gestiegen war, und den Fachfrauen des Juristinnenbundes erforderlich. Im Bereich des Strafrechts wurde für die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gekämpft, die erst 1997 ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Neben der andauernden Befassung mit den Regelungen zur Abtreibung, aktuell geht es ja um das Informationsrecht von Ärztinnen und Ärzten, die bereit sind Abtreibungen vorzunehmen, obwohl die Information angeblich unter das „Werbeverbot“ des § 219a StGB fällt, standen außerdem u. a. die Themen Stalking, weibliche und männliche Genitalbeschneidung, sexuelle Belästigung und Prostitution auf der Agenda. Zudem geht es um Regelungen im steuerrechtlichen und rentenrechtlichen System, neuerdings auch um die Frage der Parität in Parlamenten und natürlich über alle Jahre hinweg um Benachteiligungen im Arbeits- und Sozialrecht, insbesondere bei der Bezahlung und bei den Renten.
SB: Da darf ich doch gleich mal einhaken. Bis zum sog. Nachtarbeitsbeschluss des Bundesverfas-sungsgerichts von 1992 waren die Meinungen unter Verfassungsjuristen – damals noch meist männlichen Geschlechts - geteilt, ob Gleichberechtigung nur formale Rechtsgleichheit bedeutet oder ob auch ein staatliches Förderungs- oder gar Herstellungsgebot gleicher Teilhabechancen und –ergebnisse für Frauen als bislang benachteiligtes Geschlecht darunter zu verstehen ist. In diesem Nachtarbeitsbeschluss, der bestätigte, dass das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen seit einer entsprechenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Frankreich auch in Deutschland nicht mehr gilt, machte das deutsche Verfassungsgericht sehr klare und weitreichende Ausführungen dazu, was Gleichberechtigung im Sinne des Art. 3 Abs. 2 GG bedeutet, der damals nur aus dem einen Satz von 1949 bestand. Es verwarf für die Gegenwart und Zukunft zunächst einmal die alte Formel, dass traditionelle „funktionale“ Unterschiede, wie z. B. die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, unterschiedliche Rechtsregelungen rechtfertigen können. Das Verfassungsgericht sieht seitdem nur noch unterschiedliche Regelungen für Männer und Frauen als gerechtfertigt an, wenn sie zwingend wegen biologisch-medizinischer Verschiedenheit von Frauen und Männern existieren. Ansonsten schrieb es vor, dass auch mit Hilfe rechtlicher Regelungen die traditionellen Benachteiligungen und Stereotypen überwunden werden müssen und sogar zu Förderzwecken vorübergehende und verhältnismäßige Besserstellungen von Frauen als dem benachteiligten Geschlecht stattfinden dürfen. („Faktische Nachteile dürfen durch begünstigende Regelungen […] ausgeglichen werden“ (BVerfG Bd. 85 (1992), 191, 207). Das war u. a. auf die damals heiß diskutierte Quotierungsfrage für (attraktive) Beschäftigungspositionen im öffentlichen Dienst gemünzt. Durch diesen Beschluss eröffnete das Bundesverfassungsgericht den Weg zu der Erweiterung des Art. 3 Abs. 2 GG von 1994, die im Zuge der sog. kleinen Verfassungsreform nach der deutschen Vereinigung durchgesetzt wurde. Seitdem lautet die Staatszielbestimmung in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
SB: Die ergänzende Staatszielbestimmung sollte die Quotierung im öffentlichen Dienst erleichtern, um die damals so viel gestritten wurde. Aber klappte das denn und wie war diese Forderung überhaupt auf die Agenda gekommen?
US: Damit war dann abschließend der Weg zur Quote geebnet worden, die ursprünglich nicht denkbar war und als abwegige Bevorzugung von Frauen angesehen wurde. Hier halfen die im Zuge der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung nach Europa schwappenden Vorstellungen von zulässiger „positive discrimination“, dem Nachteilsausgleich, der auf Vorstellungen von Gleichheit aller Menschen beruht. Noch in den 1950er und 1960er Jahren war das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen zu Art. 3 Abs. 2 von biologischen mit funktionalen Differenzen der Geschlechter ausgegangen, einer Gleichwertigkeit bei Andersartigkeit. In den 1970er und 1980er Jahren fand ein Paradigmenwechsel zu Gleichheit mit dem Gebot der Gleichbehandlung statt und erst seit Anfang der 1990er Jahre rückte die Pflicht des Gesetzgebers, auf eine Angleichung der Lebensverhältnisse von Männern und Frauen mit Nachteilskompensation und aktiver Förderung hinzuwirken, in den Fokus.
SB: Eine wesentliche Maßnahme zur realen Gleichstellung waren ja wohl die Frauenfördergesetze der Bundesländer für den öffentlichen Dienst, die später in Gleichstellungsgesetze umbenannt wurden …
US: In der Tat war dies ein wesentlicher Schritt, 1989 war Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland mit dem nur aus zwei Paragraphen bestehenden Frauenfördergesetz in Führung gegangen. Andere Bundesländer folgten in der 1990er Jahren. Es gab Differenzen, ob weiche oder harte Quoten geboten seien, und es gab unterschiedliche Regelungen dazu. Interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht nie ein Urteil zur Quote gesprochen. Maßgeblich wurden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg (EuGH). Im Fall Kalanke verneinte der EuGH 1995 die Zulässigkeit der sog. harten Quote aus Bremen, dass bis zur Geschlechterparität in entsprechenden Positionen bei gleicher Qualifikation, Eignung und Leistung einer weiblichen Mitbewerberin immer der Vorzug zu geben sei. 1997 kam in Sachen Marschall die nordrhein-westfälische Quote mit ihrer Öffnungsklausel „sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen“ auf den Prüfstand. In dieser Fassung befand der EuGH die Quotierung für zulässig. In allen Landesgleichstellungsgesetzen der Bundesländer wurden daraufhin entsprechende Quotenregelungen festgelegt.
2016 wurde Nordrhein-Westfalen unter der damaligen rot-grünen Regierung mutig und verabschiedete – unterfüttert von einem Gutachten des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Papier – eine erweiterte Quotenregelung, die bei „im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung“ zum Einsatz kommen sollte. Jedoch wurde umgehend Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgerichtshof erhoben. Bevor dieser entscheiden konnte, hat die nach den Wahlen im Jahr 2017 an die Macht gekommene CDU/FDP-Regierung diese Regelung wieder abgeändert bzw. rückabgewickelt.
SB: Wie sieht es denn rein praktisch aus mit dem immerhin im Gesetz enthaltenen Vorrang für Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Qualifikation aus?
US: In der Praxis haben die Quotenregelungen Wirkung vor allem symbolisch einerseits als Drohgebärde mit der Gesetzeskeule als auch andererseits als Zukunftsentwurf einer geschlechterparitätischen Gesellschaft entfaltet. Zur praktischen Anwendung sind sie vor allem bei gruppenweisen Einstellungen und Massenbeförderungsverfahren im mittleren und gehobenen Dienst gekommen. Bei Führungspositionen wird dagegen so lange nach Differenzen gesucht und werden bei Beförderungen Zeugnisse so lange innerlich „ausgeschärft“, bis Wunschkandidaten durchgesetzt werden können. Dies hat exemplarisch u. a. die von mir mit einem Team für das Instituts für Gleichstellung und Geschlechterpolitik in Hagen durchgeführte Untersuchung „Frauen in Führungspositionen der Justiz“ in NRW gezeigt1.
US: Insofern zeigen sich ja offenbar gerade im Erwerbsleben eklatante Missstände in Sachen Gleichstellung. Warum geht es da nur so langsam voran bzw. geht es überhaupt voran?
SB: Es geht sehr langsam voran, wenn man bedenkt, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit schon im Parlamentarischen Rat ein wichtiges Thema war, welches insbesondere der kommunistische Abgeordnete Max Reimann eingebracht hat. Damals wurde es von den anderen Parteivertretern als Selbstverständlichkeit hingestellt, dass Frauen bei gleicher Arbeit gleichen Lohn bekommen sollten, man dachte wohl, dass dieser Fall wegen der unterschiedlichen Berufssphären und Arbeitsplätze praktisch nicht allzu häufig eintreten würde. In den 1950er Jahren gab es dann tarifliche „Frauenlohnabschlagsklauseln“ und als diese vom Bundesarbeitsgericht für unzulässig erklärt wurden, vereinbarten die Tarifparteien „Leichtlohngruppen“, in denen sich – ganz zufällig – fast nur Frauen wiederfanden. Auch heute sind noch nicht alle Tarifverträge von mittelbar diskriminierenden Elementen befreit, und vor allem nimmt die Tarifbindung rapide ab. Frauen werden häufig in geringfügige Tätigkeiten abgedrängt, in 450-Euro-Jobs und andere prekäre Arbeit. Geschlechtsübergreifend sind Befristungen, kostenlose Praktika, Zwangsteilzeit gerade in qualifizierten Tätigkeiten, z. B. sogar in den Hochschulen, ein Problem, aber Frauen trifft es fast immer stärker als Männer. Und zwar auch deshalb, weil Männer noch immer als Haushalts- und Familienernährer gedacht werden, während Frauen als Zuverdienende gelten, ganz unabhängig von den realen Verhältnissen.
US: Hinzu kommt der im europäischen Vergleich sehr große Gender Pay Gap in Deutschland …
SB: Seit Jahren beträgt die Lohnlücke immer noch 21 Prozent bei den Bruttostundenlöhnen, die Frauen weniger bekommen. Das ist die unbereinigte Lohnlücke. Aber selbst wenn man den Berechnungen von Wirtschaftsinstituten folgt, beträgt der bereinigte Gender Pay Gap, der auch von den Instituten nur durch Diskriminierung erklärt wird, immer noch etwa 6 Prozent. Beim bereinigten Gender Pay Gap wird angenommen, dass Ausgangsbedingungen von Frauen und Männern gleich sind. Das bedeutet aber keine Entwarnung, denn auch die strukturellen Unterschiede haben meist nichts mit Qualifikation und Leistung zu tun sondern mit verfestigter mittelbarer Diskriminierung wegen Geschlechterstereotypen. Z. B. stellt sich die Frage, wie ist es zu rechtfertigen ist, dass das Lohnniveau in bestimmten Branchen, die „zufällig“ Frauenbranchen sind, so viel niedriger ist als in klassischen Männerbranchen? Und warum beziehen Männer in Frauenbranchen trotz des niedrigen Lohnniveaus doch oft recht hohe Gehälter auf Leitungsposten, wenn gleich qualifizierte und erfahrene Frauen dort weniger erhalten? Bisher haben staatliche Maßnahmen diesbezüglich nicht weitergeholfen. 2017 wurde das Entgelttransparenzgesetz beschlossen, das sich aber bisher als völlig unwirksam erwiesen hat, was auch kein Wunder ist, weil es ja nur einen Auskunftsanspruch über die Gehaltshöhe von Kollegen und Kolleginnen geben soll, der in der Praxis nur schwer durchzusetzen ist.
US: Gibt es heute vielleicht sogar Bereiche, in denen Männer benachteiligt sind oder sich die Nachteile des patriarchalen Regimes so eklatant zeigen, dass sich dieses Regime von selbst zerlegt?
SB: Da die Lebensweisen von Frauen und Männern heute nicht mehr so festgelegt sind und das in-dividuelle Verhalten erst recht nicht, kann es vielfach dazu kommen, dass Männer in typische Frauensituationen geraten und diskriminiert werden, Schwule und Trans- oder Interpersonen erleben das sowieso häufig, und auch Frauen, die sich untypisch verhalten, werden dafür häufig diskriminiert. Hinzu kommt das große Feld intersektionaler Diskriminierung, wo zum Geschlecht weitere Benachteiligungskategorien hinzukommen, die spezifische Verwundbarkeiten hervorbringen. Das führt dazu, dass z. B. außer wegen des Geschlechts Frau oder Mann Menschen auch wegen der Hautfarbe, der Religion und/oder dem Alter und/oder einer Behinderung schlechter behandelt zu werden als Frauen oder Männer ohne diese Merkmale. Abgesehen davon, schafft aber sogar die rechtliche Überwindung von Frauenbenachteiligung und Geschlechterstereotypen – besonders im Zusammenhang von Ehe und Familie – neuartige Dynamiken.
Zu den seltsamen Spätfolgen des alten Geschlechterregimes fällt mir eine Randnotiz aus der Zeitung2 ein: Der Altkanzler Gerhard Schröder streitet sich neuerdings mit seiner vorerst letzten Ex-Gattin, Doris Schröder-Köpf, darüber, ob sie weiter als Teil ihres Namens seinen Namen tragen dürfe. Er meint, sie müsse seinen Namensteil ablegen, denn nur die aktuelle Ehefrau dürfe einen solchen Doppelnamen tragen. Vor 1977 konnte der geschiedene Ehemann der Frau sogar verbieten, seinen Namen weiter zu tragen, und zwar durch einseitige Erklärung beim Standesbeamten gegen die kein Rechtsmittel eingelegt werden konnte. Diese Möglichkeit ist dem aktuellen Gesetz nicht zu entnehmen (vgl. § 1355 BGB). Und zu bedenken ist auch, dass es enorme Kämpfe, Gesetzesanläufe und eine zweite Verfassungsgerichtsentscheidung im Jahre 1991 gebraucht hat, um Frauen u. a. das Recht auf Beibehaltung des eigenen Namens bei Eheschließung zu ermöglichen. Dabei wurde die 1976/77 vom Gesetzgeber gewählte Alternative zur obligatorischen Annahme des Mannesnamens, dass Frauen einen Doppelnamen unter Voranstellung ihres Namens führen konnten, schon als verwirklichte Gleichberechtigung im Namensrecht gefeiert. Die Beibehaltung der unterschiedlichen Namen von Frau und Mann wurde dagegen scharf abgelehnt und lange bekämpft wie das Weihwasser durch den Teufel. Seit 1994 gibt es die Möglichkeit der Beibehaltung der getrennten Namen bei Heirat, aber nicht alle heiratenden Frauen/Paare machen davon Gebrauch. Vielleicht gibt es praktische Gründe, vielleicht wird auch Druck ausgeübt, und es soll klar sein, dass die jeweilige Frau zu dem jeweiligen Mann gehört und umgekehrt. Angesichts dieser rechtlichen Vorgeschichte lässt sich das heutige Problem von Gerhard Schröder geradezu als dialektische List der alten patriarchalischen Logik interpretieren!
Frauen müssen auch leider beobachten, dass - sobald sie eine Position erkämpft haben- sie ihnen gern wieder streitig gemacht wird. Als in der Justiz in einem Bundesland kürzlich Richterinnen und Staatsanwältinnen den Gleichstand mit Männern erreicht hatten, wurde in Stellenausschreibungen umgehend eingefügt, dass bei gleicher Qualifikation, Eignung und Leistung Männer bevorzugt eingestellt werden.
Fazit: Es ist Vorsicht geboten, allzu optimistische Einschätzungen zum Stand der erreichten Gleichstellung erscheinen nicht angebracht. Leicht war der Kampf bisher ohnehin nicht, und das Errungene zu behalten, ist nicht selbstverständlich. Nach wie vor ist um den Ausgleich von Defiziten zu kämpfen und das Errungene – zum Teil mühsam – zu verteidigen.
1 Vgl. z. B. Schultz, Ulrike: Frauen in Führungspositionen der Justiz. Deutsche Richterzeitung 2012, S. 264 – 272.2 Der Tagesspiegel vom 09.05.2019.
Die Autorinnen

Sabine Berghahn, Dr. iur., Juristin mit zwei bayerischen Staatsexamen (1977, 1980) sowie juristischer Promotion (1991) und politologischer Habilitation (1999) in Berlin. Langjährige Tätigkeit vor allem in Lehre und Forschung an der FU Berlin (Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft), an den Universitäten Münster und Bremen, an der HWR Berlin und der FH Lausitz, gegenwärtig Privatdozentin und Rechtsanwältin.

Ulrike Schultz; 30 Jahre Leiterin des Arbeitsbereichs Didaktik der Rechtswissenschaft der FernUniversität in Hagen. Kommunikationstrainings insbes. für die Justiz, Medienarbeit. Projektmanagement großer Lehr- und Forschungsprojekte; Gendermodul für den Master of Laws. Untersuchungen zu Anwältinnen, Frauen in Führungsposition der Justiz und Genderaspekten bei Karrieren in der Rechtswissenschaft. Tätigkeit in der Gleichstellungsarbeit der FernUniversität, Autorin und Herausgeberin verschiedener, auch international vergleichender Schriften zu Geschlechterfragen; seit 1994 Koordinatorin einer internationalen Forschungsgruppe „Women/Gender in the Legal Profession“, 2010-2014 Chair der internationalen Legal Profession Group, seit 2018 Präsidentin des Research Committee for the Sociology of Law.Lebenslauf und Veröffentlichungen: http://www.ulrikeschultz.de; www.fernuni-hagen.de/jurpro; www.fernuni-hagen.de/rechtundgender
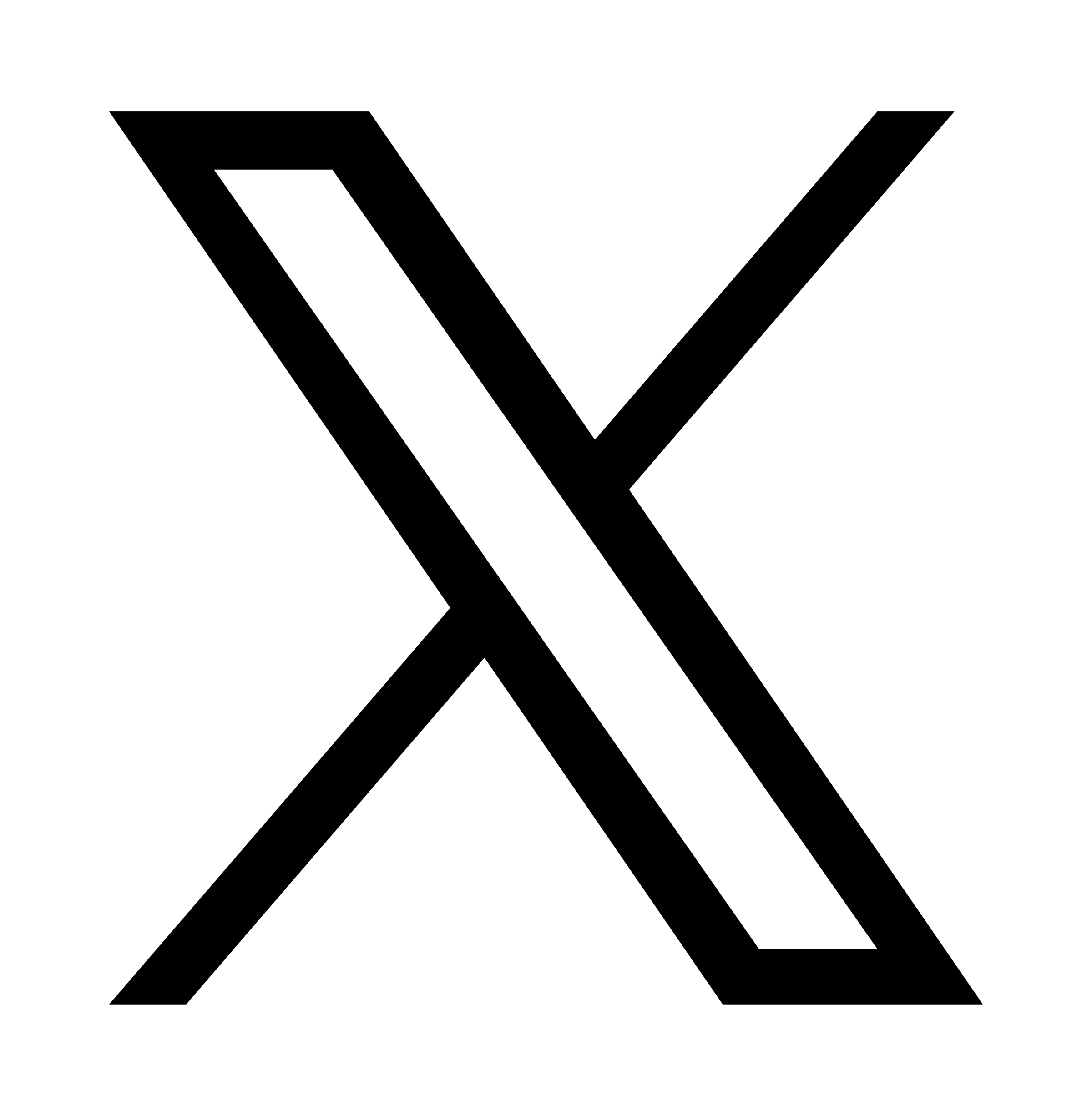 X
X
